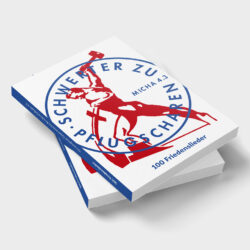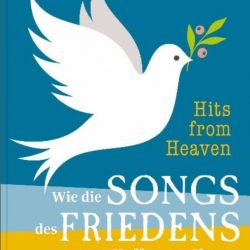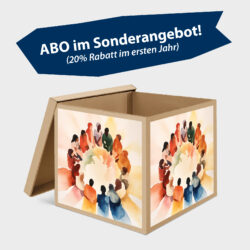„Erzähl mir vom Frieden“ – Ökumenische FriedensDekade legt Motto für 2024 fest
Bonn/Frankfurt/Fulda, 29. November 2023. Auf seiner Sitzung in Fulda hat das Gesprächsforum der Ökumenischen FriedensDekade das Motto für das kommende Jahr festgelegt. Es lautet: „Erzähl mir vom Frieden“. Im gesamten Bundesgebiet werden vom 10.- 20. November 2024 unter diesem Motto mehrere tausend Gottesdienste, Friedensgebete und Informationsveranstaltungen angeboten.
Mit dem Motto „Erzähl mir vom Frieden“ rücken die Trägerorganisationen positive Erzählungen von friedenstiftenden Initiativen in den Vordergrund. In einer Welt von derzeit 21 Kriegen, etwa in Israel/Palästina und in der Ukraine, deren Folgen für Menschen, Umwelt und den Weltfrieden verheerend sind, möchte die FriedensDekade das mehr und mehr vorherrschende Gefühl vieler Menschen aufgreifen, Frieden sei eine Illusion und nur mit Waffen und gewaltsamen Mitteln zu erreichen. „Es gibt sie, die positiven Geschichten von Menschen, Initiativen und Organisationen, die trotz Krieg und Gewalt mit gewaltfreien Mitteln für den Frieden eintreten und Wege der Versöhnung finden“, so Jan Gildemeister, Vorsitzender der Ökumenischen FriedensDekade e. V.
Dem Übermaß an negativer Berichterstattung, die von vielen als Überforderung empfunden werde, will die Ökumenische FriedensDekade mutmachende Geschichten sowohl aus Konfliktregionen als auch aus dem gesellschaftlichen wie nachbarschaftlichen Umfeld bei uns in Deutschland entgegenstellen. „Wir müssen nicht kriegstüchtig, sondern in erster Linie friedenstüchtig werden“, waren sich die Mitglieder des Gesprächsforums der Ökumenischen FriedensDekade in Fulda einig. Dazu gehöre auch, sich als gläubige Menschen dagegen zu verwahren, wenn der Name Gottes missbraucht wird, um Gewalt zu legitimieren.
Christinnen und Christen müssten sich jedweder Form von Feindbildern widersetzen und der Sehnsucht der Menschen nach Frieden und Gerechtigkeit Gehör verschaffen. „Uns geht es darum, unter dem Motto „Erzähl mir vom Frieden“ an die biblische Hoffnung auf ein gerechtes Leben für alle zu erinnern, auch in schwierigen Zeiten, in denen pazifistische Positionen kaum noch wahrgenommen, ja sogar verunglimpft werden. Die FriedensDekade will Hoffnungsbilder unter die Menschen bringen, will Anregungen geben, Polarisierungen überwinden und Feindbilder in Frage stellen“, betont Jan Gildemeister.
Als biblische Bezugsquellen zum Jahresmotto wurden aus dem Kapitel 33 des Buches Genesis (AT) die Verse 1-20 und aus Kapitel 26 des Matthäus-Evangelium (NT) die Verse 47-52 ausgewählt.
Wie in den Jahren zuvor lädt die Ökumenische FriedensDekade in den kommenden Wochen Grafiker*innen, Agenturen sowie kreative Menschen zur Teilnahme an einem Plakatwettbewerb ein, mit dem das Jahresmotto „Erzähl mir vom Frieden“ gestalterisch umgesetzt werden soll. Das ausgewählte Motiv wird ab März kommenden Jahres als zentrales visuelles Element sowohl als Plakat als auch auf allen Bildungs- und Aktionsmaterialien eingesetzt.
_____________________________________
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.friedensdekade.de.