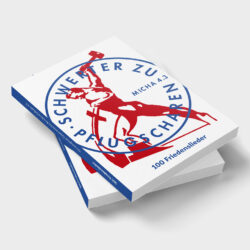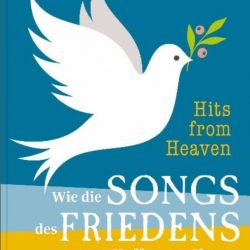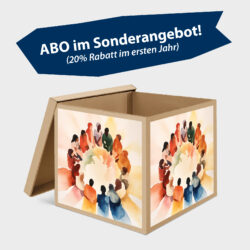“UMKEHR ZUM FRIEDEN”
Ein Beitrag von Jan Gildemeister, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) – (hier zum Download als pdf-Datei)
Unübersehbar bew egen wir uns in eine Sackgasse: Immer mehr Menschen leiden unter Umweltkatastrophen, Ungerechtigkeit und Krieg, viele Menschen müssen flüchten oder wandern unfreiwillig aus. Zugleich gibt es nicht nur weltweit Proteste, viele Menschen verlassen auch die Unheil bringenden Wege. Das Motto der Ökumenischen FriedensDekade 2020 vermittelt zwei Botschaften: Eine Abkehr von der jetzigen Praxis ist notwendig und radikale Veränderungen sind machbar.
egen wir uns in eine Sackgasse: Immer mehr Menschen leiden unter Umweltkatastrophen, Ungerechtigkeit und Krieg, viele Menschen müssen flüchten oder wandern unfreiwillig aus. Zugleich gibt es nicht nur weltweit Proteste, viele Menschen verlassen auch die Unheil bringenden Wege. Das Motto der Ökumenischen FriedensDekade 2020 vermittelt zwei Botschaften: Eine Abkehr von der jetzigen Praxis ist notwendig und radikale Veränderungen sind machbar.
Ein Blick in die Welt ist ernüchternd und frustrierend: Die wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit ist immens und wächst weiter, in sehr vielen Ländern fehlt jungen Menschen eine Perspektive. Die Umweltzerstörung nimmt zu, der Klimawandel schreitet voran und es mangelt auf allen Ebenen vielfach am Willen zur CO2-Reduktion, Müllvermeidung etc. Die Zahl der mit militärischer Gewalt ausgetragenen Konflikte wächst, die meisten Staaten rüsten auf, Atomwaffen werden „modernisiert“ und es werden nahezu ungehemmt Rüstungsgüter in alle Welt exportiert. Weitere Stichworte sind: Nationaler Egoismus und Schwächung internationaler Institutionen; Infragestellung der allgemein gültigen Menschenrechte und sinkende Handlungsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft; Rechtspopulismus, rechte und religiös motivierte Gewalt, Fakenews und Hatespeech nicht nur in sozialen Medien.
Und zugleich gibt es das Wissen um Alternativen und entsprechende Konzepte liegen vor. Im ökumenischen Kontext ist es der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, der auch nach 37 Jahren die Ausrichtung für notwendige Veränderungen beschreibt. Für Staaten sind es die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bzw. die Agenda 2030. Es ist bekannt, was sich ändern muss, die Fridays for Future-Aktivist*innen fordern „nur“ die Umsetzung von dem, was Wissenschaftler*innen empfehlen. Die Kundgebung der EKD-Synode 2019 tritt ein „für eine Ethik, eine Ökonomie und einen Lebensstil des Genug“ und stellt fest: „Eine gerechtere, ressourcen-schonendere und die Würde achtende Weltordnung ist der wichtigste Beitrag für mehr globale Sicherheit und weniger Konflikte. Die wichtigen globalen Herausforderungen lassen sich nicht militärisch lösen, sie bedürfen des politischen Ausgleichs sowie der Berücksichtigung des Rechtes und des Wohles aller Beteiligten.“
Und nicht zuletzt gibt es auch eine erfolgreiche Praxis dieser Alterativen, um nur einige Beispiele zu nennen: gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, CO2-freie Produktion, nachhaltige Landwirtschaft, gewaltfreie, konstruktive Transformation von Konflikten.
Woran hapert es, dass die notwendige „Umkehr zum Frieden“ von einer breiten Bewegung getragen wird und generell mehr Einfluss entfalten kann? Was können wir von den Regierenden erwarten? Was von einer Wirtschaft, die weltweit den Prinzipien der sogenannten freien Marktwirtschaft und dem Ziel der Gewinnmaximierung folgt?
Die Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen jedenfalls ist groß und wird in vielen Ländern auf der Straße sichtbar: insbesondere in Südamerika, aber auch in etlichen afrikanischen Staaten, in Hongkong, im Iran und Libanon sowie auch in Frankreich. Aber der Protest mündet zumeist nicht in grundlegende Veränderungen. Der Widerstand der jeweils Mächtigen ist zu groß oder neue Regierungen haben kein Interesse an einer radikalen Umkehr, ausgerichtet an den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung. Und wenn eine „Bewegung“ von unten wie im Sudan ein Regime gestürzt, einen Bürgerkrieg beendet und gewaltfreie Konflikttransformation erfolgreich auf den Weg gebracht hat, besteht die Gefahr, dass andere Akteure, darunter auch Staaten, aufgrund ihrer Interessen intervenieren und versuchen, alte Machtverhältnisse wiederherzustellen. Jenseits der Scheinwerfer unter Medien gibt es aber durchaus in vielen Regionen erfolgreiche Veränderungsprozesse, die vor allem von Frauen initiiert und getragen werden.
Der Handlungsdruck ist riesig und gefühlt gibt es genauso viele Rück- wie Fortschritte. Dennoch kann es keine schnellen Lösungen geben. So wenig wie militärische Interventionen zum Frieden führen, so wenig kann den Menschen das Umdenken verordnet werden, das für grundlegende, demokratische Veränderungen notwendig wäre. Letztlich muss der ökumenische Prozess weitergehen: Die langfristige Basisarbeit mit Informationsvermittlung, (Friedens-) Bildung und einer alternativen Praxis, Protest und politischer Lobbyarbeit u.v.a.m., wozu die AGDF-Mitgliedsorganisationen einen Beitrag leisten. Einige Bespiele: Die Friedenswoche Mutlangen setzt sich seit langem für die Abschaffung und Ächtung von Atomwaffen ein, andere AGDF-Mitglieder wie der Bund für die Soziale Verteidigung informieren über Alternativen zum Einsatz militärischer Gewalt.
Die Friedensarbeit ist in Deutschland eng verbunden mit Kriegserfahrungen. Vor 100 Jahren wurde nicht nur der Versailler Vertrag unterzeichnet, es fand auch das erste internationale Workcamp des Service Civil International statt. Und nach Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren setzten Friedensinitiativen verstärkt auf Bildungsarbeit: Angefangen von der Aufklärung über Kriegsursachen und -folgen bis hin zur Gewaltprävention und Methoden gewaltfreier Konfliktbearbeitung. Uns Deutschen reichten u.a. historische Friedenskirchen aus den USA die Hand und schafften die Ausgangsbasis für Versöhnungsprozesse und eine langfristige Friedensarbeit, wie die Geschichte des AGDF-Mitglieds ICJA Freiwilligenaustausch weltweit zeigt.
Eine permanente Aufgabe sind eine Szene übergreifende Kooperation und Vernetzung: Die Aktivist*innen von Fridays for Future können von Friedensorganisationen lernen und umgekehrt oder Eine Welt-Initiativen von Aktivist*innen für eine Agrarwende etc. Dies gilt national und natürlich auch international, oftmals verbunden mit der Herausforderung, trotz strukturellem Machtgefälle auf Augenhöhe zu kooperieren. Da haben wir noch viel miteinander zu lernen.
Das Motto der Ökumenischen Friedensdekade 2020 knüpft an die kontroversen Debatten um die Nachrüstung Anfang der 1980er Jahre an. „Umkehr zum Leben“ war die Losung des Deutschen Evangelischen Kirchentages (1983). Angesichts des NATO-Doppelbeschlusses vom Dezember 1979 zur atomaren „Nachrüstung“ in Zeiten des Kalten Krieges stand die Friedensfrage im Mittelpunkt des Kirchentages. Damals prägten die lila Tücher mit der Aufschrift „Die Zeit ist da für ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen“ nicht nur das Bild des Abschlussgottesdienstes. Die Friedensbewegung trug mit zum Ende des kalten Krieges und den nachfolgenden erfolgreichen Abrüstungsverträgen bei – die Verträge, die aktuell gekündigt werden oder auslaufen. So unbefriedigend es auch ist: Frieden fällt nicht vom Himmel, vielmehr bedarf es immer wieder vielfältiger Anstrengungen für eine „Umkehr zum Frieden“. Und Christ*innen sind gewiss: über diese langfristig angelegten Arbeit liegt Gottes Segen.